Als Medizinstudentin im Ausland
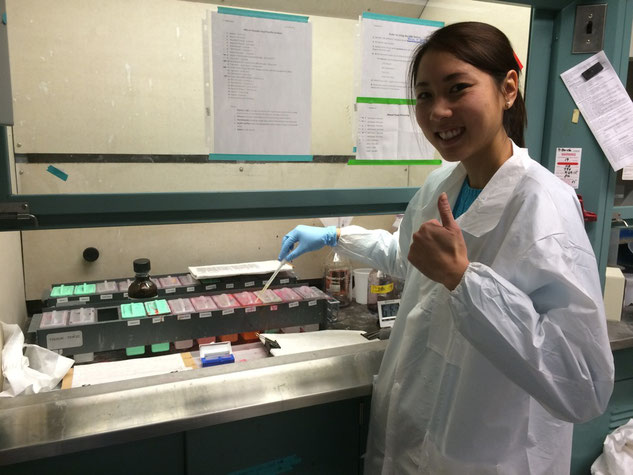
Wo hast du deine Doktorarbeit gemacht?
Sophie: Ich habe meine Doktorarbeit an der Yale University - School of Medicine gemacht, am Department of Pharmacology and Cell Physiology.
Woran hast du da gearbeitet?
Sophie: Ich habe geforscht an ADPKD und IDCM. Das steht für autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung und idiopathische dilatative Kardiomyopathie. Wir haben herausgefunden, dass Patienten, die eine Mutation im Polycystin-2-Gen haben, das bei der ADPKD eine Rolle spielt, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, auch unabhängig vom Nierenversagen diesen Typ Herzinsuffizienz zu entwickeln. Und den Zusammenhang wollte ich überwiegend durch zellphysiologische Experimente darstellen.
Wie war denn so ein typischer Tag im Labor?
Sophie: Also, am Anfang hat man als Medizinstudent ja gar keine Ahnung. Als Laborerfahrung bringt man nur das mit, was man im Biochemie-Praktikum gemacht hat. Als ich erst mal angekommen bin, wurde ich die ersten Wochen trainiert und in die Techniken eingeführt. Wenn man dann in dem Thema drin ist, können die Labortage ganz unterschiedlich aussehen. Einmal die Woche hatte ich ein Meeting mit meiner Betreuerin, um zu besprechen, ob meine Arbeit in die richtige Richtung geht und was ich besser machen könnte. Freitags hatten wir unser Lab Meeting. Das heißt, alle Labormitglieder haben sich getroffen und einer davon hat seine Ergebnisse präsentiert. Das ist ganz gut, weil man auch von der Gruppe Feedback bekommt. Außerdem gab es häufiger Seminare, die teilweise von Gastdozenten anderer Universitäten gehalten wurden. So lernt man auch etwas über andere Projekte und über den aktuellen Stand der Forschung.
Wie kamst du eigentlich zu der Doktorarbeit?
Sophie: Ich wollte schon immer eine Arbeit in der Physiologie machen, wollte aber auch ins Ausland gehen. In der Regel läuft das dann durch Eigenbewerbung. Das heißt, man schaut sich so
an, welche Labore es gibt, was mich interessiert, in welchem Bereich ich forschen möchte und schreibt dann das Labor an. Häufig ist es so, dass man ein eigenes Stipendium mitbringen muss, in den
USA nennt man das funding. Du bist ja Medizinstudent, die kennen dich nicht. Deswegen stellen sie dir zwar das Labor zur Verfügung, du wirst für die Arbeit aber (erst mal) nicht bezahlt. Darum
ist es ganz wichtig, dass man mit angibt, dass man sich selbst finanzieren kann.
Ich würde empfehlen, mehrere Labore anzuschreiben und dann das passende rauszusuchen.
Was musstest du alles organisieren und planen?
Sophie: Ich habe mich anderthalb Jahre vor meinem Auslandsaufenthalt beworben. Sich früh zu bewerben ist wichtig. Außerdem sollte man sich um sein funding kümmern. Da würde ich
empfehlen, sich für das DAAD-Stipendium zu bewerben. Wenn du als Forscher in die USA willst, brauchst du außerdem ein bestimmtes Visum. Das nennt sich J1-Visum und ist für research scholars. Das
muss man auch frühzeitig organisieren, weil es lange dauert. Dann sollte man sich um eine Versicherung kümmern. Da bieten die Universitäten oft etwas an. Und natürlich braucht man eine
Unterkunft. In den Facebookgruppen der Unis oder bei Craigslist findet man da oft was.
Weil man als Mediziner erst mal keine Laborerfahrung hat, würde ich allen empfehlen, vorher erst mal einen Monat in ein Labor reinzuschnuppern, damit man versteht wie so ein Labor funktioniert
und um ein paar Techniken zu lernen. Dein Auslandsaufenthalt ist ja zeitlich begrenzt. Da hilft es, wenn man sich den Einstieg erleichtern kann.
Wie schwer war es, sich einzuarbeiten, als Mediziner ohne Laborerfahrung und dann noch im Ausland?
Sophie: Also ich war natürlich anfangs sehr überfordert, weil ich mit unglaublich vielen Techniken bombardiert wurde. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, weil ich sehr viel lernen wollte und sehr motiviert war. Ich finde, man kommt da ziemlich schnell rein. Nach einem Monat ist man in der Materie drin.
Was muss man mitbringen, wenn man eine Doktorarbeit im Ausland machen will?
Sophie: Das ist eigentlich überall gleich, sowohl in Deutschland als auch im Ausland: Viel Motivation und eine große Frustrationstoleranz, vor allem wenn man experimentell forschen möchte. Im Studium ist es ja häufig so: Je mehr Zeit man investiert, desto besser ist das Outcome. Das ist in der Forschung nicht so. Das heißt, es gibt keine Garantie für Erfolg, keine Garantie für Publikation. Man muss also damit rechnen, dass man Scheitern kann und dass es Höhen und Tiefen gibt.
Warum hast du dich überhaupt für eine experimentelle Doktorarbeit entschieden?
Sophie: Ich wollte schon immer Grundlagenforschung machen, weil ich den Anfang der Erkrankung, dort wo die molekulargenetischen Prozesse ansetzen und die Erkrankung auslösen, besser verstehen wollte und wie man eingreifen kann, um das zu verhindern oder zu verlangsamen.
Du möchtest später vielleicht auch in den USA als Ärztin praktizieren. Was muss man dafür machen?
Sophie: Man muss das amerikanische Staatsexamen machen, wobei ein Teil in den USA absolviert werden muss. Um dann eine Stelle für die Facharztausbildung zu bekommen, sind gute Noten sehr wichtig. Im Ranking werden amerikanische Studenten höher eingestuft als ausländische. Erst wenn die amerikanischen Studenten zugeteilt wurden, werden ausländische Bewerber betrachtet. Sehr wichtig sind auch Empfehlungsschreiben, die man dort von Professoren oder Ärzten bekommt. Und die bekommt man nur, wenn man eine Famulatur oder sein PJ bei ihnen gemacht hat.
Wie ist das universitäre Leben in den USA im Vergleich zu Deutschland?
Sophie: Der größte Unterschied ist, dass es für jede Uni ein unglaubliches Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Man identifiziert sich mit der Universität und ist stolz darauf dort zu studieren. Ich finde, das fehlt leider in Deutschland. Dort gibt es ja auch Sportmannschaften und Events zu denen die Unis fahren und dann gegeneinander antreten. Das gibt es zwar auch bei uns, aber in ganz kleinem Maßstab. Die Lehre ist dort auch anders konzipiert. Wenn man dort eine Famulatur oder ein PJ-Tertial macht, ist eine eins-zu-eins Betreuung die Regel. Du hast einen Oberarzt, der nur für dich zuständig ist. Und ich glaube, da ist der Lerneffekt ziemlich groß.
Als abschließende Frage: Würdest du das alles noch mal tun?
Sophie: Definitiv. Es gab Höhepunkte und Tiefpunkte. Aber ich glaube, das braucht man auch, um zu wachsen. Denn ich denke, es ist wichtig, auch mal die Erfahrung zu machen, gescheitert zu sein, aber sich nicht von dem Scheitern unterkriegen zu lassen, sondern wieder aufzustehen.
Vielen Dank für das Interview, Sophie. Wir wünschen dir noch viel Erfolg.